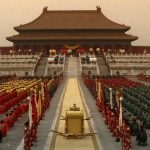Klassiker des selbstreflexiven Kinos: Francois Truffauts „Die amerikanische Nacht” (1973)
Francois Truffaut gehörte schon immer zu den Leichtgewichten der Nouvelle Vague. Wenn ein Louis Malle bei „Die Liebenden“ eine Dreiecksbeziehung in eine schwere Tragödie münden und am Ende die wahre Liebe in einem pathetischen Ausklang gewinnen lässt, inszeniert Truffaut seine Menage a Trois in „Jules und Jim“ als leichtfüßige Tragikomödie mit viel Savoir Vivre. Wo bei Jean-Luc Godard sich surreale Phantastereien ihren Weg bahnen und das Kino gar für tot erklärt wird, da macht Truffaut keinen Hehl aus seiner Begeisterung für amerikanische Vorbilder und generiert liebevolle Komödien wie „Schießen sie auf den Pianisten“ und Appelle an die Menschlichkeit wie „Der Wolfsjunge“ . Truffaut ist das warmherzige Epizentrum des avantgardistischen Kinos aus Frankreich… und dann gibt es auch noch Eine amerikanische Nacht (1973), den selbstreflexiven, leichtfüßigen Kontrapunkt zu Godards Le meprís und eine Liebeserklärung an das Kino und seine Schaffenden an und für sich.
Eine amerikanische Nacht (oder im englischen day-for-night) ist ein filmisches Verfahren, welches mittels einer speziellen aufs Objektiv angelegten Linse ein am Tag abgefilmtes Szenarium wie die dunkelste Nacht erscheinen lässt. Die Schlüsselszene von Ferrands (Francois Truffaut) Film – ein Autostunt – soll nach diesem Verfahren gedreht werden. Aber bevor es dazu kommen kann, hat der Autorenfilmer mit allerhand Problemen am Set zu kämpfen: Die junge Hauptdarstellerin Julia (Jaqueline Bisset) leidet unter Nervenzusammenbrüchen und ist mit ihrem Psychotherapeuten liiert, der Hauptdarsteller Alphonse ist eine von Selbstzweifeln zerfressene Diva, der zweite Hauptdarsteller Alexandre stirbt plötzlich während der Dreharbeiten und die Bewohner Nizzas, wo der Film gedreht wird, haben nur Verachtung für die lasterhaften Filmleute übrig. Zudem sitzt dem ambitionierten Autorenfilmer die Produktion im Nacken. Trotz alledem wagt sich der bunte Haufen aus exzentrischen Darstellern, verspielten Kameraleuten und unzähligen Set-Assistenten voller Zuversicht und Idealismus an die Arbeit des Melodrams „Je Vous Présente Paméla“.
Es ist keine große Kunst, die hier produziert wird. Das macht Francois Truffaut bereits in den ersten Szenen deutlich, wenn er den Zuschauer einer Film-im-Film-Kamerafahrt folgen lässt, die mit einer melodramatischen Ohrfeige beendet wird. Ferrand ist trotz seines Status als Autorenfilmer kein Stellvertreter des europäischen Arthouse-Kinos. Experimente der Nouvelle Vague liegen im fern, ebenso anspruchsvolle Seelenschauten. Sein Film „Meeting Pamela“ ist die europäische Version Hollywoods: Große Gefühle, große zwischenmenschliche Dramen, stringent erzählt und einer klassischen Dramaturgie folgend. Der Blick Truffauts auf die Produkte der Traumfabrik ist allerdings keineswegs ein höhnischer, überkritischer oder gar dekonstruktivistischer. Ganz im Gegenteil: Der Auteur, der schon immer – im Gegensatz zum Surrealisten Godard und zum Dekonstruktivisten Malle – zu den klassischen Erzählern des französischen Kinos gehörte, betrachtet hier mit einem liebevollen, wehmütigen Blick das Ende des traditionellen, narrativen Kinos. Es mag mitunter ein verklärter Blick sein, aber ein oberflächlicher ist es dennoch zu keiner Zeit. Der Tod des Darstellers Alexandre schockt die gesamte Crew, gleichzeitig wird aber auch darüber debattiert, wie der Film nun zu Ende gestellt werden könne. Humanität, Business und Kunst sind hier keine Antagonisten sondern gehen fließend ineinander über. Ferrand trauert über den Tod eines guten Kollegen, sieht mit ihm eine ganze cineastische Epoche sterben, zugleich setzt er aber alles daran, das Projekt zu einem zufrieden stellenden Ende zu führen… selbst wenn der Tote in einigen Szenen von einem anderen Darsteller verkörpert werden muss.
Anstatt sich in die psychoanalytischen Untiefen eines 8 ½ zu begeben, anstatt sich selbst als Autorenfilmer zu zerreißen, ist der Blick Truffauts immer ein universeller. Im Zentrum des Films steht nicht die Verkehrung von Introspektive und Expressivität sondern der Schaffungsprozess des Filmes als solcher. Egomanie und Egozentrik liegen der amerikanischen Nacht fern, ebenso die Zerfließung der Realität durch filmische Bilder. In Truffauts nostalgischem Blick wird die Produktion des Films wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. „Wir drehen diese Szene als amerikanische Nacht“, sagt der von Truffaut verkörperte Ferrand und offenbart dadurch die Techniken hinter der Illusion. Die Bilder die der Film produziert sind oberflächlich falsche Bilder, Tricks und Kniffe, Irreführungen der Rezipienten. Aber, und das wird in jeder weiteren Szene deutlich, die Gefühle dahinter sind echt. So schreibt Ferrand den Dialog seiner Hauptdarstellerin, nach einem erneuten Nervenzusammenbruch derselben, kurzerhand um. Er legt ihr dabei eben genau jene Worte in den Mund, mit denen sie ihren Zusammenbruch selbst kommentierte. Die Szene soll ehrlich wirken, soll verzaubern, zu Tränen rühren. Und wie wäre dies besser möglich, als wenn die Darstellerin in der verkörperten Figur sich selbst wieder erkennt? Truffaut arbeitet gleich mit einer doppelten Offenbarung, mit einer in sich gespiegelten Ehrlichkeit: Er gesteht die Mechanismen des Filmemachens; auf dem Beichtstuhl der Leinwand zeigt er den Zuschauern Probleme der Produktion und wie mit diesen umgegangen wird. Aber genau diese Ehrlichkeit auf der Bildebene kontrastiert mit der Authentizität auf der Textebene: Ja wir lügen in jedem Bild, aber die Gefühle, die Worte dahinter sind echt.
Dadurch wird die amerikanische Nacht zu einer Art Anti-Zizek. Hier gibt es keine Perversion, die unerreichbare Träume generiert. Hier gibt es keine Alpträume hinter dem Traum, keinen Lacan und keinen divergierenden Zeichendiskurs. Die amerikanische Nacht ist Sinnbild für die Authentizität, die hinter der Illusion verborgen liegt. So hat Truffaut auch keine Scheu davor Dialogentwürfe erst unmittelbar vor den Szenen zu beginnen, so kann er auch ohne Scham zeigen wie abhängig der Auteur von seinen Gehilfen ist, so kann er auch zugeben, ganze schneebedeckte Straßen nur zu simulieren. Der Film verkauft hier keine falsche Wirklichkeit, er inszeniert sie. Aber im Hintergrund bleibt sie dennoch präsent. Ebenso wie er damit den Zuschauer ernst nimmt, zeigt er auch große Achtung und Respekt für die gesamte Filmcrew. Das letzte Wort des Films gebührt einem scheinbar unbedeutenden Requisiteur:
Wir hoffen, dass das Publikum beim Ansehen des Films das gleiche Vergnügen hat, das wir beim Drehen hatten.