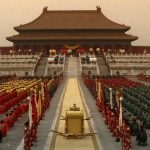1917 (2019) von Sam Mendes – Krieg als One Shot Poesie
Irgendwo an der Nordfront Frankreichs, irgendwann während des Ersten Weltkriegs. Zwei britische Soldaten liegen unter einem Baum und schlafen. Die kurze Verschnaufspause wird jedoch jäh gestört, als die beiden einen wichtigen Botenbefehl erhalten, der sie über die (vermeintlich vor kurzem geräumten) deutschen, feindlichen Linien führen soll. Wir folgen den beiden Soldaten, sind dicht bei ihnen, während sie sich durch den engen Schützengraben ihren Weg bahnen. Vorbei an anderen schlafenden, lesenden, rauchenden Soldaten, die auf ihren nächsten Befehl warten. Es ist eng und stickig. Schließlich gelangen die beiden zu einem der wenigen Durchgänge nach oben, klettern am Stacheldraht vorbei und schließlich auf das zuvor umkämpfte Schlachtfeld. Die Kamera fährt hinauf, und die eben erlebte Klaustrophobie macht einer erstaunlichen breiten Leere platz. Nie zuvor ist es einem Film gelungen, derart beeindruckend das Gefühl des Schützengrabens, des Stellungskrieges und der schieren Dimension eines Schlachtfeldes während des ersten Weltkriegs auf die Leinwand zu bringen. Die ersten fünfzehn Minuten von 1917 (2019) sind ein atemberaubendes, visuelles Erlebnis. Einer von jenen Filmmomenten, die einem glatt die Sprache verschlagen, eine erschlagende Demonstration der Ausmaße des Stellungskrieges und zugleich eine erschlagende Demonstration großen filmischen Handwerks. Und das ist erst der Anfang: Regisseur Sam Mendes (American Beauty) erzählt seine Vision des ersten Weltkrieges als Epos einfacher Soldaten und denkt dabei gar nicht daran von ihnen zu weichen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die beiden Soldaten sind die Lance Corporals Will Schofield (George MacKay) und Tom Blake (Dean-Charles Chapman). Ihr Auftrag ist es, Colonel Mackenzie (Benedict Cumberbatch) den Befehl zu überbringen, einen geplanten Angriff gegen die sich zurückziehenden Deutschen nicht durchzuführen, weil sein Bataillon damit in eine Falle laufen würde und über 1.500 Soldaten ihr Leben verlieren könnten, darunter auch Blakes älterer Bruder. Der Angriff ist bereits für den nächsten Morgen geplant, Mackenzies Bataillon einen halben Tagesmarsch entfernt. Die Zeit ist knapp und die Mission höchstriskant, weil sie direkt durch Feindesgebiet führt.
Über 1917 zu reden, bedeutet, über seinen Stil zu reden: 1917 ist als One-Shot-Movie inszeniert, der sich in Echtzeit abspielt. Auch wenn er (im Gegensatz zum deutschen Drama Victoria) nicht als solcher gedreht ist, gibt es keine sichtbaren Schnitte, keine Unterbrechungen der beeindruckenden Kameraeinstellungen von Roger Deakins (Blade Runner 2049). Und das erzeugt in diesem Fall eine ungemein immersive und zugleich lehrreiche Wirkung. Kriegsfilme haben ja generell das Dilemma, dass sie sich entweder zu sehr dem globalen Blick verschreiben (und dabei den Blick auf den einzelnen Soldaten verlieren) oder Einzelschicksalen widmen müssen (worunter wiederum die allgemeine Übersicht leidet). 1917 entkommt diesem Dilemma. Ohne Schnitte wechselt die Kamera mühelos zwischen intimen Nahaufnahmen und epischen Totalen. Am beeindruckendsten gelingt dies in der bereits erwähnten Eröffnungsszene, aber mit dieser hat der Film sein Pulver noch lange nicht verschossen. Immer wieder wandelt er von Introspektion zu monumentalem Blick, und erreicht es damit tatsächlich sowohl das Schicksal des einzelnen Soldaten spürbar, als auch die Größe des Ersten Weltkrieges erlebbar zu machen. Ohne didaktisch zu sein kann er damit seinem Publikum Fakten über das Soldatenleben, Strategien und Dimensionen des großen Krieges vermitteln. Ohne irgendetwas erklären zu müssen, erklärt er deutlich mehr als zahllose andere Kriegsfilme.
Über 1917 zu reden, bedeutet, über seine Substanz zu reden: Es wäre auch ein wenig zu leicht, sich von den überragenden Bildern, dem nahtlosen Wechsel zwischen Mensch und Schlachtfeld verführen zu lassen. Denn unter seiner Oberfläche, unter seiner technischen Perfektion und beeindruckenden Dramatik läuft 1917 in eine ganz andere Falle, in die zahllose Kriegsfilme vor ihm – unter anderem Der Soldat James Ryan (1998) – bereits gelaufen sind. Er ist zu sehr von seiner eigenen Bilderflut und dem Heldenmut seiner beiden Protagonisten fasziniert. Er ist zu sehr begeistert von seinen filmischen Möglichkeiten, seiner epochalen Visualität, seinem Blick für das Kleine und das Große. Und so vergisst er vollkommen, dem Schrecken des Krieges ein realistisches Antlitz zu geben. Es scheint müßig, darüber zu diskutieren, ob jeder Kriegsfilm ein Antikriegsfilm sein muss. 1917 jedenfalls ist keiner. Dafür steckt in dem Film zu viel Verklärung, dafür ist er zu sehr Heldenepos, zu sehr Actiondrama mit Liebe zu seinen Protagonisten und der Botschaft, dass man in extremen Situationen über sich hinauswachsen muss. Es fehlen einfach die Störgeräusche, es fehlt die Darstellung der Tristesse des Krieges, es fehlt die Verzweiflung und Ohnmacht des Einzelnen angesichts einer gigantischen Kriegsmaschinerie. Gerade der Erste Weltkrieg mit seinem absurden Stellungskrieg, seinen sinnlosen Verbarrikadierungen, seinem Fokus auf das Ausharren böte sich dafür geradezu an. Doch anstatt die Möglichkeiten dieses Schreckens auszuloten, konzentriert sich 1917 voll und ganz auf seine Mission, auf seinen Eifer und verlässt sich dabei viel zu sehr auf seine (zugegeben beeindruckende) visuelle und dramatische Stärke. Dabei hat doch erst vor kurzem Dunkirk (2017) bewiesen, dass sich epischer Pathos und Verzweiflung und Sinnlosigkeit sehr wohl unter einen Hut bringen lassen, dass es möglich ist, Krieg intensiv und zugleich ambivalent zu erzählen. Mit seinem Hang zum ausschließlich Pathetischen, Epischen wirkt 1917 dagegen antiquiert, fast schon regressiv.
Aus diesem Dilemma kommt Sam Mendes‘ Kriegsvision nicht heraus und hinterlässt so, zumindest am Ende, ein unangenehmes schales Gefühl. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie sehr verhagelt das einem die Freude am Film. Denn vor diesem schalen Gefühl ist 1917 ein durch und durch beeindruckender dramatischer Kriegsfilm, der im Visuellen und Auditiven weit über das hinauswächst, was man aus dem Genre kennt. Vollkommen zurecht für seine Kamera und seinen Sound mit einem Oscar ausgezeichnet ist 1917 ein extrem intensives Erlebnis, das mit einer unfassbaren Gekonntheit Globales und Persönliches, einfachen Kampf und epische Breite verbindet; und das ganze noch ohne störenden Schnitt, ohne Unterbrechung des Flusses. Tja, erst kommt das Fressen, dann die Moral: 1917 ist sehenswert, weil er inszenatorisch in der Tat Geschichte schreibt. Dass sich hinter der Fassade ein ziemlich eindimensionaler Kriegsfilm, einfach nur das x-te Heldenepos befindet, muss man in diesem Fall akzeptieren können. Sonst verzichtet man doch besser auf dieses audiovisuelle Erlebnis, auf diesen monumentalen Flug über und diesen intensiven Lauf durch ein Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges.