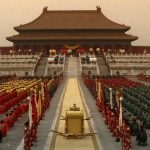Bohemian Rhapsody (2018) – Wie viel Fiktion verträgt die Realität?
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Es gibt nur wenige Bands oder Künstler*innen, auf die sich die Fans verschiedenster Genre einigen können, Bands denen anscheinend fast alle mit Wohlwollen begegnen. Queen ist eine dieser Bands: Egal ob Metal-Enthusiast, Popper, Prog- oder Classic-Rock-Guy, bei dieser Band findet jeder einen Song, zu dem er sich hingezogen fühlen kann. Und es dürfte wohl kaum jemanden geben, der der Band ihre Relevanz in der Musikgeschichte abspräche. Dass ist umso erstaunlicher, da Queen als Konsensband sich im Laufe ihrer Karriere nie als Konsensband verhalten hat. Dafür ist her royal majesty zu extravagant, zu schillernd, oft auch zu schräg und bombastisch. Und doch ist sie universal geliebt wie kaum eine Musikgruppe vor und nach ihr. Mit umso mehr Spannung und Vorfreude wurde daher die Verfilmung der musikalischen und persönlichen Laufbahn Queens und ihres Frontmanns Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody (2018), von Publikums und Feuilleton erwartet. Nicht zuletzt auch wegen der Tatsache, dass es enorm viel zu der Band und ihren Mitgliedern zu erzählen gibt, und der damit verbundenen Frage, worauf der Film seinen Fokus setzen will, und ob er mit seiner Fokussierung dem Phänomen Queen gerecht wird.
Open your eyes, look up to the skies and see
Der Musikenthusiast Farrokh Bulsara (Rami Malek), der sich zur Verschleierung seiner indischen Herkunft selbst Freddie nennt, ersingt sich in den frühen 70er Jahren ein Engagement als Leadsänger bei der Band Smile. Dank seines extravaganten Stils und seiner enormen gesanglichen Fähigkeiten gelingt es ihm schnell die Band aus der Unbekanntheit herauszuholen. Er und seine Mitmusiker Brian May (Gwilym Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) und John Deacon (Joseph Mazzello) geben sich schließlich den Namen Queen und feiern Erfolge mit einer einnehmenden Mischung aus Rock, Pop, Blues, Metal, Klassik und zahllosen anderen Einflüssen. Trotz der Vorbehalte des EMI-Produzenten Ray Foster (Mike Myers) wird ihre epische Symphonie Bohemian Rhapsody zum großen Hit, Kritiker und Fans liegen ihnen schnell zu Füßen. Doch Freddie – der sich schließlich selbst den Nachnamen Mercury gibt – pflegt einen hedonistischen und selbstzerstörerischen Lebensstil und die toxische Liebesbeziehung zu seinem persönlichen Assistenten Paul Prenter (Allen Leech) bringt nicht nur den Zusammenhalt der Band in Gefahr sondern auch Mercurys gesamtes künstlerisches und privates Leben.
Und damit ergibt sich auch gleich schon die erste Frage dieses Biopics: Braucht ein Film über die legendäre Band Queen und den legendären Leadsänger Freddie Mercury einen Bösewichten? Regisseur Bryan Singer ist offensichtlich der Meinung, ja. Anders lässt sich nicht erklären, dass ausgerechnet der Beziehung zu Prenter ein derart großer Raum im Film geschenkt wird, und dieser Prenter während der gesamten Laufzeit in mehr als schlechtem Licht erscheint. Vor allem die zentrale vermeintliche Auszeit in München und von Prenter hinterlistig erschlichene Solokarriere Mercurys, die zu Lasten der Band geht, stellen eine arge Dehnung der Realität dar. Im Grunde genommen ist der zentrale Konflikt des Films frei erfunden. Freddie Mercury war weder das einzige noch das erste Queen-Mitglied, das eine Solokarriere anstrebte. Und diese stand nie im Konflikt mit der Arbeit der Band. Anders als der Film suggeriert, gab es keine Auszeit, keine vorübergehende Trennung und keine epische Last Minute Zusammenführung zum epischen Live Aid Auftritt 1985. Aber auch über diese – seien wir ehrlich – glatte Geschichtsklitterung hinaus, gibt es so manche Realitätsüberhöhung, -verschleierung und -ignorierung in Bohemian Rhapsody.
Because I’m easy come, easy go, little high, little low.
„We’re making a movie here, not a documentary“ kommentierte Drehbuchautor Anthony McCarten zu der Frage nach der historischen Akkuratheit seiner Geschichte. Und natürlich ist da was dran. Es besteht grundsätzlich kein Problem darin, Realität zu verkürzen, umzudichten, zu komprimieren oder auszuschmücken, um in einem Spielfilm die maximale dramatische Wirkung zu erreichen. Viele historischen Filme und Biopics haben das bereits getan. Das Problem von Bohemian Rhapsody besteht darin, dass seine bewussten Ungenauigkeiten, seine bewussten Realitätsverzerrungen sowohl der Geschichte als auch dem Drama eher schaden, als ihm zu nützen. Er ist immer genau dann am besten, wenn er auf das forcierte Melodram verzichtet, wenn er nicht versucht die Realität zu überhöhen, sondern sie in ihrer Besonderheit im Kleinen feiert. Diese stärksten Momente von Bohemian Rhapsody sind die kleinen Konflikte der so eingeschweißten Band beim Songwriting, seine stärksten Momente sind die Szenen im Tonstudio, wo Egos aufeinanderprallen und sich dennoch zusammenreißen, um ein bestmögliches Kunstwerk zu schaffen. Seine stärksten Momente sind die, in denen deutlich wird, wie wenig Queen allein von der Person Freddie Mercurys lebte und viel mehr eine eingeschworene Gemeinschaft großer Einzelkünstler war, die alle (!) an dem künstlerischen Werk Anteil hatten.
I see a little silhouetto of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?
Dadurch, dass sich Bohemian Rhapsody so sehr auf das große (in der Realität nie stattgefundene) Drama stürzt, verkennt er ein wenig, was die Band trotz ihrer Konflikte und trotz Mercurys so überbordendem Ego so besonders machte: Ihre Fähigkeit mehr zu sein als die Summe der einzelnen Teile, sowohl Kunstwerk als auch Künstler, Schöpfer und Schöpfung. Es wird im Laufe des Films allzu oft deutlich, dass Bryan Singer und Dexter Fletcher keinen Queen- sondern einen Freddie Mercury Film drehen wollen, keine Liebeserklärung an die Musik, sondern ein persönliches Biopic. Nur ist Bohemian Rhapsody als Drama und Biopic am schwächsten, als Liebesbrief an Queen am stärksten. Das liegt auch daran, dass es ihm nie so ganz gelingt die Besonderheit der Person Freddie Mercury einzufangen: Ihm Fehlt der Blick für Mercurys – bei aller Zerrissenheit vorhandene – Lebensfreude, ihm fehlt das Gespür für seine Sensibilität und seine Fähigkeit sich zu Gunsten der Band zurückzunehmen. Viel zu oft begeht Bohemian Rhapsody den Fehler, den auch viele Medien der 80er Jahre begingen: Er verwechselt den in der Öffentlichkeit im Vordergrund stehenden, extrovertierten Freddie Mercury mit dem loyalen, alles für die Band gebenden Künstler Freddie Mercury; er stellt in seinen schwächsten Momenten Queen als Einmann-Projekt dar, obwohl er eigentlich wissen müsste, dass genau das Gegenteil der Fall war. So tut er nicht nur der Band unrecht, sondern auch Mercury selbst und auch seinen engsten Vertrauten, so wie seinem langen und treuen Lebenspartner Jim Hutton, dem er lächerlich wenig Leinwandzeit zugesteht.
Das soll aber nicht heißen, dass alles schlecht ist an Bohemian Rhapsody. Der Film ist äußerst mitreißend inszeniert, vor allem die Live-Performances der Band – allen voran der Live Aid Auftritt, dem ihr gebührend viel Platz eingeräumt wird – werden in ihrer Extravaganz außerordentlich gut eingefangen. Das ist vor allem dem grandiosen Schauspiel zu verdanken. Dass Hauptdarsteller Rami Malek einen fantastischen Freddie Mercury abgibt, wurde schon mehr als genug geschrieben und ist wenig überraschend. Allerdings überraschend ist die tatsache, dass auch die anderen Bandmitglieder hervorragend gespielt werden. Mehr noch, Gwilym Lee, Ben Hardy und Joseph Mazzello ergänzen nicht nur Maleks exaltierten Auftritt, in ihrem vergleichsweise subtilen Spiel überstrahlen sie ihn mitunter. Durch ihre kleinen, aber umso wirkungsvolleren Reaktionen schenken sie der Figur Mercury deutlich mehr Leben, als dies Malek allein könnte, und gleichzeitig arbeiten sie perfekt die Persönlichkeiten ihrer eigenen Rollen heraus. Dass ausgerechnet die vermeintlichen Nebendarsteller der eigentliche schauspielerische Pfeiler sind, ist bei einem Film mit einer derart exzentrischen Hauptfigur besonders beeindruckend und kann gar nicht genug hervorgehoben werden.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me!
Und dann ist da noch die Musik, die ebenfalls vieles an dem Film rettet. Easy könnte man meinen, bei einem Film über derart gute Musiker und derart gute Songs. Deren Einzigartigkeit fängt Bohemian Rhapsody gekonnt ein, wenn er ihnen mal Raum gibt (was leider alles in allem zu selten vorkommt). In einer fantastischen Tourmontage, einem tollen Ritt durch die Entstehung und zeitgenössische Rezeption der namensgebenden Rockoper Bohemian Rhapsody, durch einige exzellente Schnitte vom Studio zur Bühne, von der Schöpfung zum Erlebnis. Die Leidenschaft, die Originalität, die Diversität und der Eklektizismus Queens werden in diesen (es sei noch einmal gesagt zu seltenen) Momenten tadellos in Film gebannt.
Bohemian Rhapsody ist am besten, wenn er Musikfilm ist. Am schwächsten ist er als Biopic und Charakterdrama. Leider ist er ersteres viel zu selten, letzteres viel zu oft. Gerade wegen seines sehr freien Umgangs mit der realen Geschichte Queens dürfte er so manche Fans der Band verärgern. Aber mit seiner soliden Inszenierung, seinem hervorragenden Schauspiel und seiner glaubhaften Liebe für die dargestellte Musik ist der doch stark genug, um hier eine knappe (wirklich knappe) Sehempfehlung zu erhalten. Mal sehen ob das Elton John Biopic mehr kann…
Nothing really matters, anyone can see
Nothing really matters
Nothing really matters to me.
Any way the wind blows…