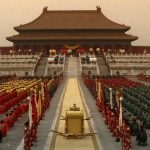Die versunkene Stadt Z (2016) – Anachronistisches Abenteuerkino
These 1: Es gibt zwei Arten von Abenteuerfilmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die erste düster und unheimlich, oft auch realistisch daherkommt, und ihre Abenteurer direkt ins Herz der Finsternis (Pun intended) führen, macht die zweite Abenteurer zu großen Actionhelden, die jeder noch so erschreckenden Gefahr mit einem Augenzwinkern, einer cleveren Idee, puren Muskeln oder einer schnell geschwungenen Peitsche trotzen. These 2: Indiana Jones ist schuld daran, dass die erste Sorte Abenteuerfilme zu Beginn der 80er Jahre praktisch ausgestorben ist. Mit der Verschmelzung des Abenteuerfilms mit dem (amerikanischen) Blockbusterkino wurde die Idee eines Abenteurers geboren, in dessen Welt Überlebenskämpfe und Desillusionierung keinen Platz haben. These 3: Das Abenteuerkino ist ziemlich tot. Nach den Erfolgen der Indys und Crocodile Dundees kümmerte sich das Mainstreamkino in den 90ern und noch mehr im frühen 21. Jahrhundert immer weniger um die großen, übermenschlichen Entdecker. Diese fanden eine zweite Heimat im Medium des Videospiels. Wenn man heute an große Archäologen und Abenteurer denkt, kommen einem eher Lara Croft und Nathan Drake in den Sinn als Indiana Jones und Jack T. Colton. Es ist keine Überraschung, dass der erfolgreichste Abenteuer-Blockbuster des letzten Jahrzehnts, Jumanji – Welcome to the Jungle (2017), in einer Videospielwelt stattfindet. These 4: Die Suche nach dem Herz der Finsternis und der Kampf ums Überleben fanden in den letzten Jahren eine neue Heimat in domestizierten Abenteuergeschichten, die nicht auf fremden Kontinenten und exotischen Settings angesiedelt sind, sondern in der Heimat der Protagonisten und Protagonistinnen. Man denke nur an die Initialzündung dieses Trends, Into the Wild (2007) oder die Outodoor-Selbstfindung Der große Trip – Wild (2014), vielleicht auch an die im Zuge dieses Trends entstandenen Familiengeschichten wie Captain Fantastic (2016) oder Schloss aus Glas (2017). Fünfte und letzte These (versprochen): Abenteuerfilme, egal ob sie um große Abenteurer*Innen kreisen, oder den Kampf ums Überleben vor exotischer Kulisse zum Thema haben, können diesbezüglich nur anachronistisch wirken. Und genau das ist The Lost City of Z (2016) auch… ein durch und durch filmischer Anachronismus, sowohl was Geschichte als auch Produktion als auch Inszenierung betrifft.
Das beginnt schon bei der Produktionsgeschichte. Bevor die literarische Vorlage überhaupt publiziert wurde, wurde Drehbuchautor und Regisseur James Gray (Ad Astra) 2008 von Paramount und Plan B beauftragt, das Werk filmisch umzusetzen. Ganze sieben Jahre sollte es dauern, bis der fertige Film schließlich zum ersten Mal auf eine öffentliche Leinwand projiziert werden sollte. Es war eine schwere Geburt, sowohl was das Schreiben als auch den Dreh betrifft, im Grunde genommen genau so, wie man es von einem klassischen Abenteuerepos erwartet. James Gray sprach selbst von einer komplizierten Produktion und äußerte darüber hinaus die Angst, dass Die versunkene Stadt Z zu seinem Fitzcarraldo werden würde. Klassisch ist auch die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruhend in einem historischen Setting, dem frühen 20. Jahrhundert angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht der britische Offizier Percival Harrison Fawcett (Charlie Hunnam), der im Jahre 1906 im Auftrag seiner Majestät zum ersten Mal in den südamerikanischen Dschungel reist. Dort entdeckt er Artefakte, die auf eine uralte, hochkultivierte Zivilisation hinweisen. Und der Gedanke daran lässt ihn einfach nicht los. In den folgenden Jahren wird er allen Widerständen zum Trotz mit seinem treuen Gehilfen und Begleiter Henry Costin (Robert Pattinson) weitere Forschungsreisen in den Dschungel unternehmen, immer in der Hoffnung, die von ihm auf den Namen Z getaufte, verschollene Stadt zu entdecken. Dabei wird er mit Widerständen von Außen und von Innen konfrontiert, die aber nichts an seiner anthropologischen Besessenheit ändern können.
Es sind immer ein wenig Otto Lidenbrock, ein wenig Phileas Fogg, die in dieser Besessenheit mitschwingen, aber The Lost City of Z lässt trotzdem keinen Zweifel daran, dass wir es hier nicht mit einem Jules Verne Märchen zu tun haben. Dafür ist die Reminiszenz an den Abenteuerklassiker zu vage gehalten und wird viel zu sehr von ermattendem Realismus erdrückt. Die Reisen von Fawcett sind keine Abenteuerreisen, die Konfrontationen mit der wissenschaftlichen Elite, die er von einer verborgenen Zivilisation zu überzeugen versucht, sind keine launischen Diskussionsrunden, und die Begegnungen mit anderen Völkern sind kein exotisches Zuckerschlecken. Aber auch die Angst Grays, in Gefilde eines Fitzcarraldo oder Aguirre abzurutschen, sind unbegründet. Die Suche nach der versunkenen Stadt wird nie zum wahnhaften Trip ins Reich der Finsternis, es gibt keine experimentellen, psychedelischen oder schlicht höllischen Werner Herzog Momente. Der Realismus, um den der Film bemüht ist, wird nie zum brutalen Naturalismus, der alles verschlingt, was an Hoffnung da sein könnte. Tatsächlich bewegt sich The Lost City of Z zwischen den beiden Genreextremen vergangener Zeiten, bevor Indiana Jones in den frühen 80er Jahren alles wegspülen sollte, was es davor an Abenteuerkino gab. In dessen Gefilde rutscht dieses Abenteuerdrama indes nie ab: Es gibt keine großen Actionsequenzen, keine glorreichen Kämpfe, keine B-Movie Bösewichter. Grays Film ist eine Hommage an das Abenteuerkino, das sich selbst und sein Publikum ernst nimmt. Weit weg vom Pulp-Spaß eines Indiana Jones, weit weg von jeglichen Action- und Exploitationklischees erzählt er ruhig, manchmal auch melancholisch und wenn er größere Dramen auffährt, verkommen diese nie zum Selbstzweck.
Das liegt auch daran, dass es neben den eigentlichen Abenteuerreisen ein zweites emotionales Epizentrum gibt, das der Geschichte eine zutiefst tragische Note verleiht. Zwischen den Reisen nach Südamerika werden wir immer wieder mit Fawcetts Familie konfrontiert. Seine Frau Nina (Sienna Miller) leidet unter seiner Entdeckerfreude, kann es nicht verstehen, dass er immer wieder loszieht und sie und ihre Kinder zurücklässt. Aber auch Fawcett selbst ist hin- und her gerissen zwischen Fern- und Heimweh. Und er muss miterleben, wie ihm sein Leben – während er unterwegs ist – entgleitet. Seine Kinder werden älter, können sich bei Wiederbegegnungen kaum an ihren Vater erinnern, er ist fast ein Geist für sie, der kurz auftaucht, nur um dann gleich darauf wieder zu verschwinden, sei es für die nächste Entdeckertour oder zum Krieg, in den er eingezogen wird. Wenn Fawcett unterwegs ist, scheint seine Zeit still zu stehen, einzig ausgerichtet auf das imaginäre Ziel Z. Währenddessen läuft die Zeit in der Außenwelt unverblümt weiter. Der Dschungel kennt keine Uhren, keine alltäglichen Verpflichtungen, er ist wie ein schwarzes Loch, dass alle aufsaugt, die sich in seine Nähe wagen. Und während dieses schwarze Loch jegliches Gefühl von Zivilisation verschlingt, geht das Leben draußen seinen Gang weiter. In seinen tragischsten Momenten präsentiert Z seinen Protagonisten als Opfer für die Wissenschaft, für die Welt der Entdeckungen, für das Versprechen eines Abenteuers.
Dennoch wird The Lost City of Z nie zum tiefgründigen Psychodrama. Dafür investiert er doch zu viel Energie in die Evokation einer getragenen, gediegenen Atmosphäre, dafür beschäftigt er sich doch zu sehr mit dem bloßen Fließen der Zeit, mit dem bloßen Suchen nach Antworten. Im Grunde kümmert sich The Lost City of Z wenig um das Innenleben seiner Protagonisten und Protagonistinnen. Sie dienen viel mehr als Schablone um den inneren Zwiespalt zwischen Fernweh und Heimweh aufzuzeigen. In seinem ruhigen, unnuancierten Spiel könnte Charlie Hunnam fast als Avatar für die Zuschauerinnen und Zuschauer stehen, als Verkörperung einer Zerrissenheit, mit der wohl jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben konfrontiert ist. Insofern fällt es nicht schwer, mit ihm mitzufiebern, mit ihm zu erleben, aber auch mit ihm Mitleid zu empfinden. Obwohl The Lost City of Z auf einer wahren Geschichte basiert, will er wie die ganz klassischen Epen universelle Erzählung sein, will anhand einer Einzelperson auf große menschliche Konstanten hinweisen. Vielleicht verliert er sich dabei selbst hin und wieder in seinem eigenen zähen, manchmal auch spröden Fluss. Aber auch dies hat er mit den ganz traditionellen Abenteuer- und Monumentalfilmen der Marke Lawrence gemein: Er bewegt sich elegant, aber etwas ziellos, er fließt stetig, aber manchmal etwas träge, er präsentiert ein wunderschönes, mitreißendes Bild, bleibt bei diesem Bild aber an der Oberfläche. Vielleicht ist es zu negativ, darin einen reinen filmischen Anachronismus zu sehen. Denn in all seiner Zurückhaltung, seiner Trägheit, seiner Eleganz und vor allem seiner Unzeitgemäßheit ist The Lost City of Z ein wirklich spannender, einnehmender und unterhaltsamer Film. Und gerade weil das Genre ein bisschen tot ist und wir folgerichtig viel zu selten noch derart klassisches Abenteuerkino präsentiert bekommen, eine absolute Bereicherung für die ausgehenden cineastischen 2010er Jahre.